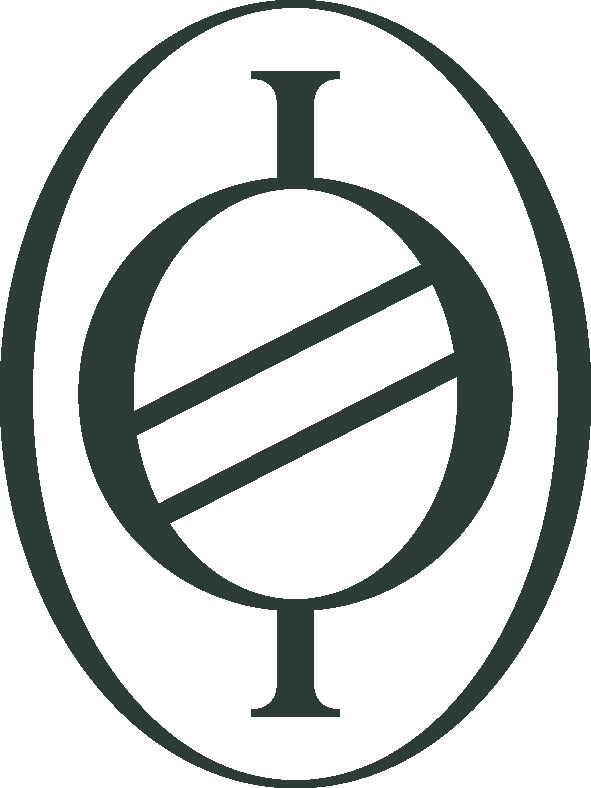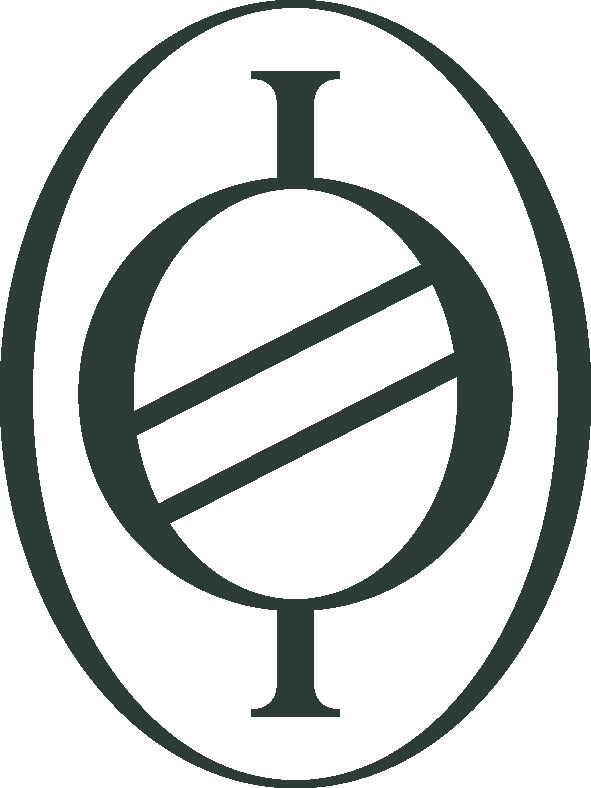
Erasmus-Rezeption zwischen Politikum und Herzensangelegenheit
Dulce bellum und Querela pacis in deutscher Sprache im 16. und 17. Jahrhundert
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort, V
Verzeichnis der Abbildungen, XII
I. Einleitung
- A. Die Wurzeln von Erasmus’ Friedensdenken, 1
- B. Der schriftliche Niederschlag von Erasmus’ Friedensdenken, 6
- C. Das Bellum-Adagium in den deutschen Landen, 26
- D. Die Querela pacis, 31
- E. Anliegen der Arbeit, 35
- F. Vorgehen und Arbeitsweise, 41
II. Ulrich Varnbülers Der Krieg ist lustig dem vnerfarnen von
1519
- A. Theorie und Praxis des Übersetzens im 16. Jahrhundert, 49
- B. Erasmus und das Übersetzen, 54
- C. Varnbülers Bellum-Übersetzung von 1519
- 1. Der persönliche Anlaß, 57
- 2. Das Verhältnis zur Übersetzungstradition, 60
- 3. Die Art zu übersetzen, 69
III. Fridericus Cornelius von Friedensbergs Der Krieg ist zwar ein
suesse Speiß von 1607
- A. Der unbekannte Übersetzer, 81
- B. Die Analyse der Übersetzung
- 1. Der Umgang mit antikem Bildungsgut und mit der christlich-theologischen
Tradition, 83
- 2. Flüchtigkeitsfehler und Akzentverlagerungen, 105
- 3. Friedensbergs persönlicher Standort, 115
IV. Caspar Meußlers Schoene vnd nachdenckliche Rede von
1659
- A. Das historische Umfeld, 125
- B. Meußler als Vermittler von Erasmus’ Gedankengut. Analyse
der Übersetzung
- 1. Die lutherische Sicht, 136
- 2. Übersetzerische Freiheit und die Grenzen von Meußlers
Können, 145
- 3. Meußlers Umgang mit antiken Quellen, 173
- 4. Lateinische Kompaktheit. Satzanalytische und idiomatische
Schwierigkeiten, 179
- 5. Vertretbare und fehlerhafte Auslassungen, 188
- 6. Das Bezugssystem des Übersetzers und des anvisierten
Lesers, 196
- 7. Der Übersetzer als schlichter Vermittler: translatio
und imitatio, 206
- C. Schluß, 209
V. Joachim Gerdes’ Krieg und FriedesKlage von 1666
- A. Ein Versuch zur Kontextualisierung von Erasmus’
Friedensschriften
- 1. Der programmatische Zusammenhalt, 215
- 2. Die gesammelten Friedensschriften, 222
- 3. Gerdes’ Versuch einer Legitimierung des Türkenkrieges:
Ein unvergreifliches Bedencken/ wegen der Tuercken Einfalls Jn der
Christenheit Grentzen, 245
- B. Gerdes’ Bellum-Interpretation. Analyse der
Übersetzung
- 1. Der Umgang mit den Quellen, 248
- 2. Behutsames Übersetzen und verfehltes Nuancieren, 258
- 3. Lexikalisches Geschick, 266
- 4. Nuancierung und übersetzungstechnische Schwierigkeiten, 275
- 5. Übersetzerische Freiheiten gegenüber der Vorlage –
aemulatio-Versuche und Exkurse, 288
- 6. Lesehilfen und Zeugnisse der persönlichen Involviertheit, 298
- C. Die Übersetzung als sprachliches Kunstwerk, 312
VI. Die Querela pacis in deutscher Sprache
- A. Wirkungskraft und Wirkungsgeschichte, 319
- 1. Leo Juds Übersetzung von 1521, 320
- 2. Georg Spalatins Übersetzung von 1521 und ihr Nachleben
- a. Der Erasmus-Vermittler und sein Übersetzungs-programm, 340
- b. Die Neuausgabe von 1566, 347
- c. Spalatins Art zu übersetzen. Die beiden Ausgaben im
Vergleich, 348
- B. Die deutsche Querela im 17. Jahrhundert, 363
- 1. Die einzelnen Übersetzungen, 371
- 2. Die Klag des außgejagten Friedens als
Kompilation, 385
- 3. Gesamtbild, 394
- C. Beobachtungen zur produktiven Rezeption der Querela
- 1. Johann Rists Irenaromachia, 395
- 2. Diederich von dem Werders Friedens Rede, 401
VII. Zusammenfassung und Ausblick, 421
Bibliographie
- A. Siglen, 431
- B. Primärliteratur, 432
- C. Sekundärliteratur, 452
Register
- A. Personenverzeichnis, 463
- B. Ortsverzeichnis, 469